
Frauen leben länger und verhalten sich gesundheitsbewusster als Männer. In einem bestimmten Bereich erweisen sich Frauen dennoch als das schwächere Geschlecht. Sie sind von einer Reihe psychischer Erkrankungen wie Depression, Angst- und Essstörungen wesentlich häufiger betroffen als Männer, heißt es im jüngst veröffentlichten gemeinsamen „Frauengesundheitsbericht“ des Robert Koch-Instituts und des Statistischen Bundesamtes.
Die gesundheitlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich schon früh: In der Kindheit sind Mädchen gesünder und medizinisch unauffälliger als Jungen. Im Alter von sieben bis zehn Jahren sind sie zum Beispiel seltener von Asthma, Heuschnupfen und psychischen Auffälligkeiten betroffen, während dagegen im Kindesalter bei Jungen häufiger psychische Auffälligkeiten, wie Verhaltensprobleme, Hyperaktivität und emotionale Probleme festgestellt werden. Im Jugendalter kehrt sich dann das Geschlechterverhältnis teils um: Mädchen leiden im Vergleich zu Jungen häufiger unter Schmerzen, Schlafstörungen und Schwindel. Sie weisen auch häufiger Hinweise auf Essstörungen und Symptome von Depression und Angst auf. Mädchen berichten deutlich häufiger als Jungen, oft Stress zu erleben und mit ihrem Körper und Aussehen unzufrieden zu sein.
Trotzdem scheinen Mädchen und Frauen insgesamt eine bessere Gesundheit aufzuweisen als Jungen und Männer. Noch niemals zuvor hatten neugeborene Mädchen in Deutschland die Chance auf eine derart lange Lebenszeit von etwa 83 Jahren. Etwa ein Fünftel der heute geborenen Mädchen könnten sogar den 100. Geburtstag erleben.
Der kontinuierliche Anstieg der Lebenserwartung hat jedoch nicht nur positive Seiten: Diese Entwicklung hat auch zur Folge, dass viele Menschen lange mit chronischen Krankheiten leben. Jede zweite Frau ab 65 Jahren ist beispielsweise von Arthrose betroffen, etwa jede Sechste ist an Diabetes mellitus erkrankt. Dennoch bewertet unter den Frauen ab 65 Jahren immerhin fast die Hälfte die eigene Gesundheit als gut oder sehr gut.
Rollendenken beeinflusst Diagnostik und Therapie
Psychische Erkrankungen verkürzen zwar nur relativ selten das Leben, beeinträchtigen jedoch die Lebensqualität und können zu oftmals langfristiger Arbeitsunfähigkeit führen. Wenngleich psychische Störungen bei beiden Geschlechtern häufig vorkommen, sind Frauen doch von einigen Formen, vor allem von Depression, Angststörungen und Essstörungen, deutlich öfter betroffen als Männer.
Bei der Entstehung psychischer Störungen spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise genetische Prädisposition, hormonelle Einflüsse oder psychosoziale Faktoren wie Arbeitslosigkeit oder Partnerschaftsprobleme. Frauen sind zudem häufiger Opfer von Gewalterfahrungen als Männer und auch dies kann psychische Störungen begünstigen. Eine weitere Erklärung für die unterschiedliche Prävalenz liefert ein Gender-Bias in der ärztlichen Wahrnehmung und daraus folgender Diagnosestellung und Therapie, denn auch Ärztinnen und Ärzte sind nicht immer frei von unbewussten Geschlechter-Rollenbildern. So erhalten Frauen bei gleicher Symptomatik häufiger eine psychische Diagnose, während bei Männern eine somatische Diagnose gestellt wird.
In den letzten Jahren sind die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Problemen und Verhaltensstörungen deutlich gestiegen. So betrug der entsprechende Anteil an Fehlzeiten am Arbeitsplatz 2017 bei Frauen 14,3 Prozent, bei Männern 8,6 Prozent und lag damit bei Frauen an zweiter Stelle nach den Krankheiten des muskuloskelettalen Systems (20,8 Prozent).
Ein weiteres Indiz für die steigende psychische Belastung von Frauen: 2015 wurden 42.677 Frauen aufgrund von psychischen Problemen und Verhaltensstörungen frühberentet, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2000. Störungen der psychischen Gesundheit verursachen dabei die höchsten Krankheitskosten bei Frauen mit 27,7 Milliarden Euro und einem Gesamtkostenanteil von 14,6 Prozent.
Rollendenken beeinflusst oftmals auch die Diagnostik und Therapie bei Depression.
Diese äußert sich bei Frauen eher durch Symptome wie Unruhe, Traurigkeit oder Selbstzweifel. Bei Männern ist sie meist durch Aggressivität, Irritabilität, sozialen Rückzug, Substanzmissbrauch und Stressgefühle gekennzeichnet.
Stereotype Rollenzuschreibungen sowie Unterschiede in der Symptomäußerung und -wahrnehmung zwischen Frauen und Männern können zu einer Verzerrung in der Depressionsdiagnostik und -therapie führen: Frauen berichten psychische Symptome in der Regel häufiger als Männer, auch werden Frauen mehr Psychopharmaka ärztlich verordnet.
Die Lebenszeitprävalenz einer diagnostizierten Depression beträgt bei Frauen 15,4 Prozent, bei Männern nur 7,8 Prozent. In der Altersgruppe der 60-bis 69-jährigen Frauen sind die Prävalenzen einer selbstberichteten, ärztlich diagnostizierten Depression mit 22,9 Prozent am höchsten. Die Häufigkeit einer Depressionsdiagnose ist zudem bei alleinerziehenden Frauen größer als bei solchen, die in einer Partnerschaft leben.
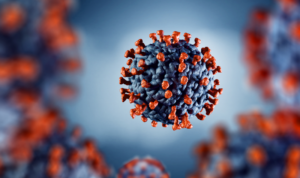
Bildunterschrift: Frauen sind durch die Corona-Pandemie besonderen Stress-Belastungen
ausgesetzt.
Bildnachweis: AdobeStock_330524737_artegorov3@gmail
Männer sterben häufiger an Suizid
Im Jahr 2017 starben in Deutschland 2.251 Frauen durch Suizid, Männer dagegen mit 6.990 Sterbefällen rund dreimal häufiger. Zwar kommen Suizidversuche bei Frauen (vor allem bei jüngeren) häufiger vor als bei Männern, die Anzahl der vollzogenen Suizide ist jedoch bei Männern höher, was unter anderem mit der Wahl von gewalttätigeren Suizidmethoden zusammenhängt.
Von allen Suiziden werden 65 bis 90 Prozent durch psychische Erkrankungen verursacht, am meisten durch Depressionen. Auch die fehlende Aussicht auf Heilung bei schweren chronischen Erkrankungen kann zu Selbstmordgedanken führen.
Als weitere Risikofaktoren gelten Trennungen und Beziehungskonflikte, Minoritätenstress (gesellschaftliche Stigmatisierung), der Tod einer nahestehenden Person, ökonomische Krisen oder Arbeitslosigkeit.
Unter den psychischen Erkrankungen weisen auch Essstörungen eine hohe Letalitätsrate auf. Die Entwicklung dieser ernstzunehmenden Erkrankungen beginnt zumeist im Jugendalter oder jungen Erwachsenenalter. Sie lassen sich im Wesentlichen unterteilen in
- Anorexia nervosa,
- Bulimie und
- Binge-Eating-Störung.
Bei allen Störungen liegt ein problematischer Umgang mit dem Verzehr von Nahrungsmitteln und dem eigenen Selbstbild vor. Grundsätzlich können die Krankheitsbilder jederzeit einem Syndromwandel unterliegen und ineinander übergehen.
Daten der Krankenhaus-Diagnosestatistik zeigen, dass es im Jahr 2017 bei Frauen und Mädchen 10.357 stationäre Behandlungsfälle aufgrund von Essstörungen gab, bei Männern und Jungen waren es nur 1.018.
Durch Magersucht bedingtes Untergewicht kann zu erheblichen, mitunter lebensbedrohlichen körperlichen Funktionsstörungen führen. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Anorexie zu versterben, beträgt immerhin 5,5 Prozent; sie hat damit die höchste Letalitätsrate unter allen psychiatrischen Erkrankungen. Im Jahr 2017 sind in Deutschland 66 Frauen an Essstörungen verstorben, davon 42 an Anorexia nervosa, eine an Bulimie und zwölf an einer Binge-Eating-Störung.
COVID-19 – Frauen stärker belastet, Männer schwerer erkrankt
Frauen und Männer haben ein unterschiedliches Risiko, an einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu erkranken oder einen schweren Krankheitsverlauf bei COVID19 zu entwickeln. Bisherigen, nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten zufolge ist das Risiko für Männer höher, an einer COVID-19-Erkrankung zu versterben oder schwerere Symptome zu entwickeln. Von psychischen und sozialen Folgen der Pandemie sind dagegen Frauen stärker betroffen. Sie arbeiten oft in systemrelevanten Berufen, wie zum Beispiel in der Krankenpflege oder als Verkäuferinnen und leisten einen großen Teil der Sorgearbeit in den Familien.
In Deutschland sind rund 4,2 Millionen Frauen im Gesundheitswesen tätig (Männer 1,4 Millionen). Am häufigsten sind die in Gesundheitsberufen beschäftigten Frauen in ambulanten Einrichtungen tätig (44,1 Prozent), gefolgt von stationären und teilstationären Einrichtungen (37,0 Prozent), sonstigen Einrichtungen (7,8 Prozent), Vorleistungsindustrien des Gesundheitswesens (z.B. pharmazeutische oder medizintechnische Industrie 6,6 Prozent) und in der Verwaltung (3,4 Prozent).
Die Anzahl der Frauen in Gesundheitsberufen ist zwischen 2012 (3,8 Millionen) und 2017 (4,2 Millionen) leicht gestiegen, wobei die Zahl der beschäftigten Frauen insbesondere im Bereich der Altenpflege zunahm.
Auch wenn Kindertagesstätten und Schulen geschlossen sind, stehen Frauen vor besonderen Schwierigkeiten: Die Pflege von Familienmitgliedern, die Kinderbetreuung, Home-schooling und Haushaltstätigkeiten lasten überwiegend auf ihren Schultern. So wird durch die Corona-Pandemie die klassische Rollenverteilung zusätzlich weiter zementiert.
Frauen drohen durch Covid-19 zudem erhebliche ökonomische Konsequenzen:
Die ersten Entlassungswellen im Zuge der COVID-19-Pandemie betrafen vor allem Sektoren, in denen Frauen überrepräsentiert sind, wie Einzelhandel, Gastgewerbe und Tourismus.
Kognitive Fähigkeiten: Frauen im Vorteil
Im Hinblick auf die meisten Bereiche der Wahrnehmung sind Frauen besser ausgestattet, z. B. was Tastsinn, Gehör, Geruch und Geschmack betrifft, so der Ulmer Psychiater Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer. Sie können besser räumlich sehen und sind feinmotorisch geschickter als Männer (Spitzer M., Das starke Gehirn des schwachen Geschlechts, Nervenheilkunde 2007; 26: 337–341).
Soziale, emotionale und sprachliche Fähigkeiten sind beim männlichen Geschlecht weniger gut ausgeprägt als bei Mädchen bzw. Frauen. Schon im Säuglingsalter erkennen Mädchen Gesichter besser und interessieren sich stärker für andere Menschen.

Bildnachweis: AdobeStock_329584573_Halfpoint
Frauen besitzen zudem bessere kommunikative Fähigkeiten als Männer. Mädchen wissen mit 16 Monaten im Durchschnitt 13 Wörter mehr als gleichaltrige Jungen. Mit 20 Monaten beträgt der Vorsprung 51 und mit zwei Jahren 115 Wörter. Im Alter von 20 bis 30 Monaten sprechen Mädchen häufiger spontan und verwenden auch komplexere grammatikalische Strukturen häufiger und fehlerfreier als Jungen.
Mädchen werden im Vergleich zu Jungen im Durchschnitt früher eingeschult und haben im weiteren schulischen Verlauf bessere Leistungen in der Lesekompetenz, wiederholen seltener eine Klasse und bleiben seltener ohne Schulabschluss.
Erwachsene Frauen gebrauchen täglich etwa 20.000 Wörter, Männer dagegen nur 7.000. Auch ihr verbales Gedächtnis ist besser als das von Männern.
„Nicht umsonst sind die Großmütter die besten Erzähler von Geschichten“, so der Ulmer Experte.
Lajos Schöne
PK 5/2021